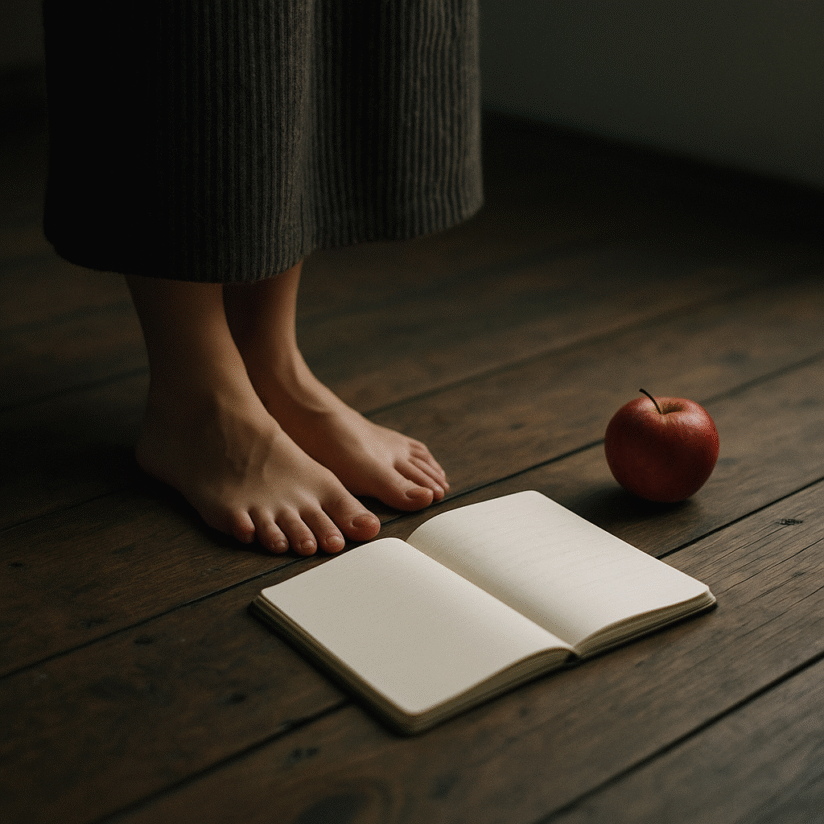
November 2025 – Die Dunkelheit als Leselampe
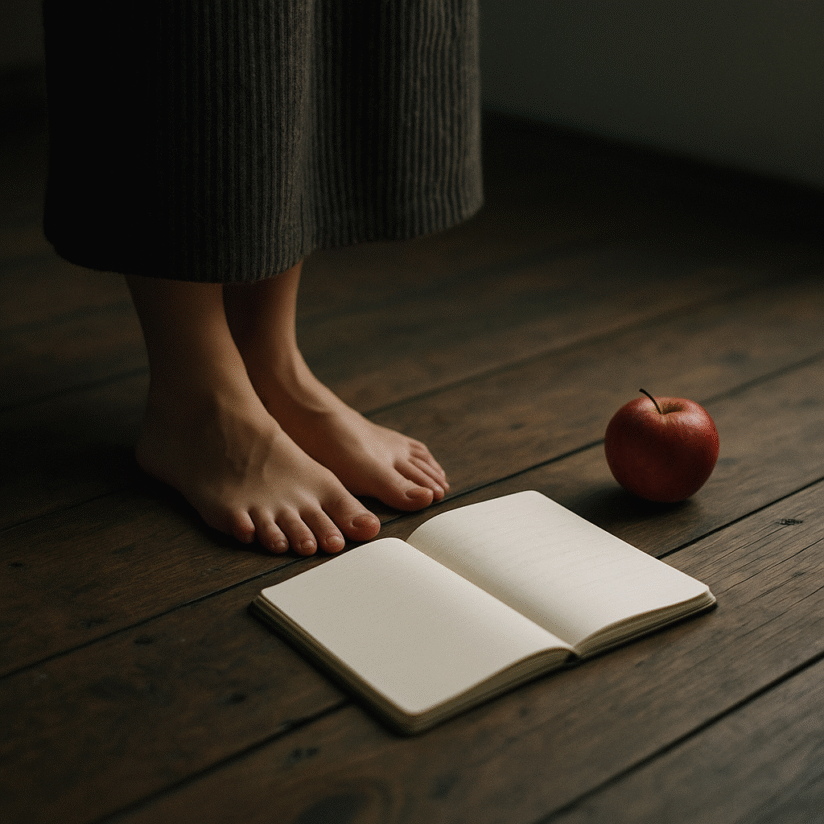
Ein intimer November-Text über Grenzen, Atem und Ankunft
Ich bin heute früh wach geworden, bevor das Dorf, in dem ich lebe, ein Gesicht hatte. Der November hängt wie ein schweres Samttuch über den Häusern, draußen zündet irgendwer den Nebel an und tut so, als wäre das Wetter schuld. Ich koche Wasser, das pfeift wie ein kleines, beleidigtes Orchester, lehne am Fenstersims und halte die Stirn gegen die kalte Scheibe. Es gibt Tage, an denen du die Welt im Außen hörst, wie sie klimpert und verlangt: Schau her, schau her! Und andere Tage, an denen du sie einfach durchschauen kannst. Heute ist letzteres. Der Lärm der Schlagzeilen ist da – Börsen, Bündnisse, irgendwer droht irgendwem – aber in mir ist nur dieses stille Metronom: atmen, zuhören, bleiben.
Die Zeitqualität macht keine Komplimente. Sie ist ehrlich, beinahe unverschämt. Auf der geopolitischen Bühne schieben Staaten Möbel, als wäre die Erde ein Wartezimmer. Ich sehe das Zittern in den Gesichtern der Leute an der Supermarktkasse, höre es im Tonfall der Nachrichten, der so tut, als wäre Panik eine Form von Information. Aber wenn ich zwischen den Zeilen lausche, höre ich etwas anderes: eine Beharrlichkeit, die nicht in Beton gegossen ist, sondern in Herzschlag. Es ist, als hätte die Welt einen neuen Takt angenommen, holprig, unberechenbar, und unsere Körper versuchen, mitzuzählen. Sie stolpern, ja – doch sie lernen schnell.
Ich trinke meinen Pfefferminz Tee, beobachte den Dampf, wie er eine Sekunde lang Priester spielt, sich dann auflöst und dem Raum zurückgibt, was er ihm genommen hat. Dieser November fordert nicht: Er lädt ein, zu einer Sorte Mut, die keine Zeugen braucht. Der Mut, still zu sein, während draußen alles sprintet; der Mut, zuzuhören, auch wenn die Antwort das eigene Narrativ zerkratzt. Ich habe mir abgewöhnt, das „Große“ zu suchen – diese dramatischen Offenbarungen, die leuchten wie Automaten in der Nacht. Das Wahre ist kleiner geworden und dadurch gewichtiger. Ein Blick, der nicht flieht. Ein Nein, das nicht rechtfertigt. Ein Ja, das nicht vibriert vor Angst.
Gestern Abend habe ich mich auf den Boden gesetzt, Rücken an die Heizung, Hände auf dem Bauch. Kein Ritual für Instagram, kein Soundtrack, nur Atem. Die erste Minute war ein Flohzirkus im Kopf, die zweite ein bisschen weniger, und in der dritten war da dieses sanfte, fast unverschämte Wissen: Ich muss nichts werden, ich muss mich erinnern. Das ist, was Medialität in diesen Wochen für mich ist – kein exotisches Tor, sondern eine Rückkehr. Die Intuition kommt nicht wie ein Feuerwerk; sie schnippt dir im Vorbeigehen gegen die Schulter und erwartet, dass du nicht so tust, als hättest du’s nicht gemerkt.
Draußen fährt der Lieferwagen für die diesjährige Heizöllieferung vor, meine kleine Hündin bellt höflich, als wüsste sie, dass Lärm gerade Luxus ist. Ich denke an die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die uns alle in die Knie zwingt, wenn wir sie wie Kleingeld behandeln. Also zahle ich heute in anderer Währung: zwei Minuten Himmel, barfuß über kalte Dielen, ein Apfel, so langsam gegessen, als würde er mir ein Geheimnis diktieren. Ich habe begriffen, dass Balance nicht passiert, weil du sie einplanst, sondern weil du sie wiederholst. Kleine, unauffällige Wiederholungen – wie das Wegdrehen vom Drama, ohne Pathos, dafür zuverlässig wie eine gute Türklinke.
Wenn ich arbeite, lese ich Menschen mehr als Worte. Im November gehört zu jedem Satz ein Untertitel, der nicht ausgesprochen wird: „Ich will gesehen werden, ohne ausgeliefert zu sein.“ Es ist der Monat, der dich höflich aus dem Theater deiner Rollen komplimentiert. Nicht brutal, aber konsequent. Der Vorhang fällt nicht; er wird transparent. Du merkst, wie viel du behauptet hast, um nicht zu fühlen. Und wie entwaffnend leicht es ist, zuzugeben, dass du müde bist, ohne gleich zu verschwinden.
Die Weltlage? Ein Magnet, der mal zieht, mal stößt. Ich lasse mich informieren, nicht kolonisieren. Das ist der Unterschied, den es braucht, um nicht innerlich zu zerbröseln. Es hilft, die Dinge beim Namen zu nennen, ohne ihnen Wohnung zu geben. Ja, Märkte zittern. Ja, Bündnisse knarzen. Ja, der Planet verlangt nach Ernsthaftigkeit. Und trotzdem: Mein Nervensystem ist keine Reißleine für fremde Dramen. Ich schulde der Wirklichkeit meine Gegenwart, nicht meinen Kollaps.
Zwischendurch gehe ich zum Fenster, lege die Stirn erneut an das Glas. Es ist kühler geworden, so kühl, dass meine Haut die Grenze respektiert. Grenzen sind im November das eigentliche Sakrament. Sie sind nicht hart, sie sind präzise. Ich übe die Art von Nein, die den Raum nicht verschließt, sondern ihn klärt. Wenn mich jemand um Zeit bittet, die ich nicht habe, sage ich: Mein Kalender ist einem anderen Versprechen verpflichtet. Das ist wahr. Es klingt gut. Vor allem ist es geerdet. Man kann Spiritualität in viele Hüllen kleiden – aber wenn sie nicht im Körper landet, bleibt sie Theaterrauch.
Später, am späten Nachmittag, wird der Himmel violett. Dieses Violett, das tut, als wäre es schon Nacht, obwohl noch Restlicht da ist. Ich schreibe Namen von Menschen auf, denen ich etwas schulde: eine Entschuldigung, ein Danke, ein Ich-sehe-dich. Keine großen Gesten. Eine Sprachnachricht, ein Satz, der akzentfrei in die Wahrheit fällt. Ich habe gelernt, dass die feinste Magie relational ist. Keine Feuerspur, kein Regen aus Sternenstaub. Nur die zarte, mutige Bereitschaft, einen halben Schritt näher an das zu treten, was wirklich ist.
Wenn mich jemand fragt, was der November will, antworte ich ungern in Zukunftsform. Ich sage: Jetzt. Er will dich jetzt – unprätentiös, wach, unaufgeräumt, aber anwesend. Er will, dass du die Dunkelheit als Leselampe benutzt, nicht als Grube. Dass du deine Angst wie eine Figur am Rand des Spielfelds begrüßt und sie nicht mehr zum Schiedsrichter machst. Er will, dass du die Mikroentscheidungen ehrst: Wasser statt weiterer Kaffee. Ausatmen vor Senden. Drei Wörter für die Tagesqualität, auf einen Zettel geschrieben und gelebt wie einen kleinen Vertrag: klar, langsam, wahr. Oder: weich, entschieden, hier. Such dir dein Triptychon.
Spät in der Nacht, als das Dorf endlich verhandelt hat mit sich selbst, sitze ich noch immer am Tisch. Auf dem Holz liegt eine Karte aus dem wunderbaren Orakel meines Herzensmedium, die ich nicht gezogen habe, sondern gefunden – zwischen zwei alten Notizen, die längst keinen Auftrag mehr haben. Sie zeigt eine offene Tür in einer Mauer. Kein Glitzer, keine Pfeile, nur Öffnung. Ich lache leise, denn manchmal ist Symbolik so unverschämt direkt, dass man sie fast übersieht. Ich muss nicht durchrennen. Ich muss hindurchgehen, in normaler Geschwindigkeit, meinen Namen mitnehmen und das alte Echo an der Schwelle lassen.
Bevor ich das Licht lösche, lege ich zwei Hände auf mein Herz, wie ein Notar, der den Tag beglaubigt. Ich sage nicht viel. Nur diesen einen Satz, der sich anfühlt wie ein sauber gefegter Hausflur: Ich bin hier. Es reicht. Der Rest findet mich, wenn ich nicht mehr so laut suche. Und falls morgen wieder alles ruckelt – gut. Ich habe inzwischen einen Takt im Blut, der nicht vom Außen bezahlt wird.
So schreibt sich der November in meine Rippen: ohne Trompeten, mit Haltung. Und wenn es ein Schlusswort braucht, dann dieses, unscheinbar und unbedingt: Der Weg ist nicht lang. Er ist präzise. Jede ehrliche Minute zählt doppelt. Und manchmal ist das Höchste, was du tun kannst, die Klinke zu drücken und in den Raum zu treten, der schon immer auf dich gewartet hat.
Steven